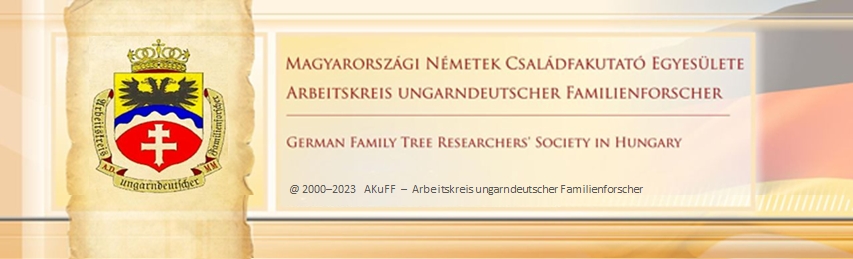Dr. Paul Flach
(1907-1991)
Sein Leben und Werk
Dr. Paul Flach ist am 21. Januar 1907 in Waschkut/Vaskút geboren. Sein Ahn auf der Flach’schen Linie kam in den 1740er Jahren aus Ulmbach bei Schlüchtern/Hessen nach Tschatali/Csátalja, er war also ein waschechter „Stifulder”, die meisten Vorfahren von Dr. Flach aber stammten aus Oberschwaben, aus der Umgebung des heiligen Berges der Schwaben, des Bussens. Die nach Tschatali/Csátalja und nach Hajosch/Hajós eingewanderten Ahnen wurden im 18-19. Jahrhundert bereits Waschkuter.
In diesem hübschen Nordbatschkaer Dorf hat Paul als Sohn von Gregor Flach, Schnapsbrenner und Kaufladeninhaber und Marianne Christmann das Licht der Welt erblickt. Er hatte noch eine Schwester Agathe, verh. Wollner.
Der begabte Junge kam nach der Bürgerschule, 1918 ins Gymnasium der Zisterzienser in Baja, wo er 1926 das Abitur gestanden hatte. Er wurde Student an der Juristischen Fakultät der Franz-Josef-Universität in Segedin/Szeged, wo er 1932 zum Doktor der Rechtswissenschaften promovierte.
Er kam zurück in die Nähe seines Heimatdorfes und wurde Rechtsanwaltkandidat beim Rechtsanwalt Dr. Johann Mojzes in Baja und zum Schluss ab 1938 selbständiger Rechtsanwalt in unserer Stadt. Als solcher bewies er seine große Gerechtigkeitsliebe.
Er vergaß nie seine Wurzeln, trotz der Madjarisierungsbestrebungen der ungarischen Macht in der Zwischenkriegszeit war und blieb ein treuer Sohn seiner deutschen Volksgruppe.
Diese Treue nicht nur in Gedanken und Gefühle zu bewahren wurde er Mitglied des Volksbundes der Deutschen in Ungarn am 17. November 1940, an der Gründungssitzung der Ortsgruppe von Baja, wo er zugleich zum Ortsvorsitzenden gewählt wurde. Bei schwerem Widerstand der ungarischen Mehrheit, besonders des assimilierten Deutschen vitéz Miklós Bessenyői (ursprünglich Baldesweiler), dem Generaldirektor der Bajaer Sparkasse hat er die deutsche Bürgerschule, den deutschen Kindergarten und Schülerheim in Baja gegründet. Solche deutsche Bürgerschulen gab es im damaligen Ungarn außer Baja nur in Hidasch/Hidas, Deutschbohl/Németbóly, und Großkarol/Nagykároly. So können wir seinen Einsatz ganz besonders schätzen. Heute ist nicht einmal das Gebäude dieser Schule zu sehen, in der Erinnerung der meisten Bajaer, vielleicht auch den meisten Deutschen lebt sie nicht mehr.
Im Frühjahr 1945 musste Dr. Flach nach Deutschland fliehen, zuerst nach Garmisch-Partenkirchen, dann im Juli nach München, wo er eigentlich sein neues Zuhause fand.
Auch in der neuen Heimat hat er alles für seine Landsleute getan, 1947-1950 war er Leiter der im Rahmen der Kirchlichen Hilfsstelle wirkenden „Beratungsstelle für deutsche Flüchtlinge und Ausgewiesene aus Ungarn“. Dank seines hohen Schulabschlusses und guten Sprachkenntnis fand er 1951 eine gute Stelle in der Bayerischen Staatsbibliothek, wo er der Leiter der damals ausgebauten Ungarischen Sektion wurde. 1972 ging er in Ruhestand.
Als Pensionist fang für ihn eine neue, aber ebenso, vielleicht mehr aktive Periode, wie früher an. Der Geist, der zuerst im Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein und dann im Volksbund der Deutschen in Ungarn schaffte, nämlich die Forschung der Vergangenheit und Kultur unserer deutschen Volksgruppe, lebte in ihm weiter. Er wurde einer der aktivsten Forscher in diesem Thema. Bereits in den 1960er Jahren erschienen kleinere Schriften von ihm, in den 70er Jahren fand er aber Zeit auch für großzügige Werke.
Die Krone auf seiner Tätigkeit war sein 1983 in München herausgegebenes Buch über sein Heimatdorf Waschkut. Das Werk bearbeitet in über 700 Seiten die Dorfgeschichte thematisch gegliedert nach den einzelnen Sequenzen der Geschichte, der Kultur und des Lebens der Waschkuter Deutschen. Das Buch ist bis heute die wichtigste Quelle für Lokalpatrioten und Familienforscher.
Auch in seinen anderen Werken erscheint seine Vorliebe für die deutschen Vorfahren. Lange Zeit wechselte er Briefe mit dem damaligen Bussenpfarrer, Josef Paul. Mit ihm zusammen und mit der Hilfe der damals noch als Manuskript existierenden Quellenarbeiten über die Auswanderungen aus den südwestdeutschen Gebiete von Werner Hacker hat er so viel über die Herkunft der Deutschen von Hajosch und Waschkut veröffentlicht und zum Gemeingut gemacht, wie niemand zuvor. Er schrieb aber ähnliche Bücher über Tschasatet/Császártöltés und der reformierten deutschen Gemeinde Pustawam/Pusztavám auch. Kleinere Hefte schrieb er auch über einzelnen Waschkuter Familien, so unter Anderen über seine Vorfahren.
Er blieb aber auch der Stadt Baja anhängig. Seine gründliche kleine Arbeiten über einzelnen Themen aus Dokumente des Wiener Hofkammerarchives, wie die Geschichte der Deutschen Pfarrei von Baja, die Hausbesitzerliste von 1803, die deutschen Gassennamen von Baja, die königlichen Privilegienbriefe der Stadt usw. sind auch heute die besten Quellen, deren Zeilen sogar heute in Artikeln von ungarischen Heimatforschern in den Lokalzeitschriften fast wortwörtlich übersetzt erscheinen (leider ohne Quellenangabe, man hat seinen Namen und Tätigkeit nur in einem einzigen Artikel erwähnt in dem ihm mehr Beschimpfungen wegen seiner Tätigkeit im Volksbund als Belobungen für seinen geistigen Nachlass zukamen).
Seine Werke (wohl nicht alle):
• Goldene Batschka – Ein Heimatbuch der Deutschen aus der Batschka (München 1953)
• Richtigstellung des Aufsatzes von Ladislaus Buzás über Franz Anton Basch (München, 1954)
• Von Jakob Bleyer bis zur Gegenwart – Kritische Abhandlungen (München 1955)
• Dr. Franz Anton Basch (1901-1946) zum Gedächtnis (München 1956)
• Dichtung und Wahrheit über das ungarländische Deutschtum (München 1956)
• 200 Jahre Vaskút-Eisenbrunn (Der Ungarndeutsche. Jg. 3. 1959)
• Ritter der Menschlichkeit (Der Ungarndeutsche. Jg. 5. 1961)
• Von Apati bis Apatin (Straubing 1966)
• Geschichte von Kunbaja / Werden und Vergehen einer deutschen Gemeinde in der Nordbatschka (München 1967)
• Ortsgruppengründungen des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins (1924-1940) und des Volksbundes der Deutschen in Ungarn (1938-1941) (München, 1968)
• Siedlungsgeschichte von Császártöltés einer deutschen Gemeinde an der nördlichen Grenze der Batschka (München 1969)
• Beiträge zur historischen Geographie der ehemaligen Komitate Bács und Bodrog sowie des einstigen Solter Stuhles (München 1969)
• Unsere Familiensage. Die Sage einer deutschen Sippe in der Nordbatschka (München 1969)
• Andreas Jelky, der Robinson Ungarns (München 1970)
• Die behördlichen Bestätigungen der Ortsgruppen des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins (1924-1940) und des Volksbundes der Deutschen in Ungarn (1938-1941) (München, 1971)
• Ahnenforschung. Einzelheiten über die Familien Flach, Schoblocher und Ternay (München 1972)
• Zur Entstehungsgeschichte der deutschen Pfarrei und Pfarrkirche von Baja sowie der anderen Pfarreien, Kirchen, Kapellen, Friedhöfe und Statuen der in der nordwestlichen Batschka (Ungarn) befindlichen Stadt. (München 1974)
• Ahnen und Urheimat. Einzelheiten über die Familien Christmann, Gutsch (Kutsch), Bischof, Sujer (Soyer) und Weber (München 1976)
• (mit Josef Paul) Siedlungsgeschichte von Hajós einer schwäbischen Gemeinde an der nördlichen Grenze der Batschka. (München 1976)
• Die deutschen Gassennamen der Stadt Baja und der umliegenden Ortschaften, (München 1977)
• Die Hausbesitzer der Stadt Baja um 1803 (München 1977)
• Zur Geschichte der Deutschen Bürgerschule in Baja-Frankenstadt (München 1978)
• Zur Vergangenheit von Pusztavám einer deutscher Gemeinde in Ungarn (München, 1978)
• Die königlichen Privilegienbriefe der Stadt Baja (Ungarn (München 1979)
• Das ungarländische Deutschtum im Spiegel der amtlichen Volkszählung vom 31. Januar 1941 (München 1979)
• Erinnerungen und Ereignisse (München 1979)
• Waschkut, Beiträge zur Geschichte einer überwiegend deutschen Gemeinde in der Batschka/Ungarn (München 1983)
• (mit Paul Schwalm) Waschkut erzählt und singt. Sitten und Gebräuche einer deutschen Gemeinde in der Batschka/Ungarn (München 1985)
Leider konnte Dr. Flach das bewundernswert hohe Alter von 101 Jahren, wie sein Vater, nicht erleben, er starb am 7. Juni 1991 in Gröbenzell bei München mit 84 Jahren. Wer weiß, wie viele Pläne von ihm unverwirklicht blieben.
Wie Anton Treszl in seinem Werk (Wer ist wer, Erstes ungarndeutschen Biographielexikon) schreibt: „P.F. war ein bescheidener Mensch, der jede öffentliche Würdigung und Auszeichnung ablehnte”.